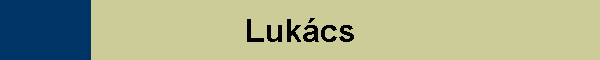
![]()
|
|
|
|
Marx-Engels-Stiftung - Wuppertal, 1. Februar 2014
Dieter Kraft
Georg Lukács’ „Die Zerstörung der Vernunft“ - zweimal gelesen
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde!
Was ist irrational? Irrational ist, wenn ausgerechnet ein marxistischer Philosoph ausgerechnet einen evangelischen Theologen um einen Beitrag zu Lukács’ Kritik des Irrationalismus bittet. Ich hätte mich darauf auch nie eingelassen, wenn der Philosoph Arnold Schölzel nicht ein uralter Freund und zudem mein einstiger Führungs-FDJler gewesen wäre. Aber ein Fehler war es wohl dennoch, hier zuzusagen, denn was ich heute vorzutragen in der Lage bin, ist für Philosophen wahrscheinlich höchst uninteressant. Ich kann nur darüber sprechen, wie das vor 42 Jahren war, als ich „Die Zerstörung der Vernunft“ zum ersten Mal las. Ungern spreche ich aber darüber, wie es überhaupt dazu kam, denn es ist mir noch heute etwas peinlich. Es war wohl am Ende des 2. Studienjahres an der Sektion Theologie der Berliner Humboldt-Universität, als mein späterer Doktorvater Hanfried Müller auf mich zukam und mir zwei Fragen stellte: 1. ob ich denn Lust hätte, bei ihm Hilfsassistent zu werden - und 2. ob ich denn schon den Lukács gelesen hätte. Die erste Frage fand ich ganz fabelhaft, denn als Hiwi hätte ich 100,- Mark im Monat zusätzlich zum Grundstipendium gehabt. Die zweite Frage irritierte mich etwas, denn der Name Lukács sagte mir nicht besonders viel, nur dieses, daß er sich kürzlich begeistert über Herrn Solschenizyn geäußert haben sollte, und Solschenizyns „Krebsstation“ (1967) und sein Nobelpreis-Roman „Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch“ (1962) waren unter Theologiestudenten Geheimtips. So gut kannte ich Hanfried Müller aber schon, daß ich mir beim besten Willen nicht vorstellen konnte, von ihm eine Laudatio des Lukács ausgerechnet auf Solschenizyn anempfohlen zu bekommen. Warum dann aber seine Frage? Vermutlich merkte Müller meine Irritation und setzte nach: „Ich meine den Lukács, die Zerstörung der Vernunft natürlich.“Dieses Opus kannte ich nicht, und wahrscheinlich hätte ich es damals noch gar nicht gelesen, wenn ich nicht einem weiteren Mißverständnis aufgesessen wäre. Ich dachte nämlich, daß Müller wohl der Meinung wäre, die Lektüre dieses Buches sei die Voraussetzung dafür, bei ihm Hiwi werden zu können. Also kaufte ich mir den Band antiquarisch - für stolze 45,00 Mark der Deutschen Demokratischen Republik - eine riesige Summe für damalige sozialistische Verhältnisse, von der ich im Studentenwohnheim mehr als zwei Monate Miete hätte bezahlen können. Zuerst beeindruckte mich dieser Kaufpreis, der mir irgendwie und subkutan wohl auch signalisierte, daß es sich hier halt um ein ganz besonders bedeutendes Werk handeln müsse. Und dann beeindruckte mich die Dicke. Fast 700 Seiten. Nun gut, es wären nicht die ersten gewesen, aber zunächst hat mich zur Lektüre nur der Gedanke an den Hiwi und die 100 Mark motiviert.Aber nun wird es ernst, vielleicht auch ein wenig ungemütlich. Denn was ich heute über Lukács denke und sage, das deckt sich keineswegs mit dem, was ich vor 42 Jahren gedacht habe. Das Buch wurde für mich geradezu zu einer Zerreißprobe. Ich war hin- und hergerissen von Lukács’ Urteilen, denn bei so manchen Delinquenten hatte ich mich doch schon eingenistet. Nicht bei Schopenhauer und erst recht nicht bei Nietzsche. Schopenhauer hatte ich nicht verstehen, will sagen: nicht nachvollziehen können und fand seinen chronischen Pessimismus einfach blöd und pathologisch. Erst bei Lukács habe ich gelernt, daß Schopenhauer eigentlich auch gar kein richtiger Philosoph, sondern eher ein Ideologe ist, den man ideologiegeschichtlich, mithin also politisch einordnen muß, um „Wille und Vorstellung“ verständlich plazieren zu können. Um so mehr wunderte ich mich, daß es aber offenbar zum akademischen Ton bestimmter theologischer Vorlesungen gehörte, einen Schopenhauer ganz selbstverständlich zur Sprache zu bringen. In meiner ersten „Evangelischen Ethik“, die ich las und die in der DDR erschienen und weitgehend mit einer entsprechenden Vorlesung identisch war, nimmt er im Personenregister nach Martin Luther und Karl Barth mit 15 Verweisen und ausführlichen Texten sogar Platz 3 ein. Jesus steht übrigens auch im Register, aber nur 10 Mal.
Offenbar kannte der Autor dieser Ethik den Lukács auch nicht. Oder er war nicht gewillt, Lukács’ Urteil gelten zu lassen, das da sehr hart, aber auch sehr klar lautet: „Von Schelling und Schopenhauer geht ein steiler Weg abwärts - über Nietzsche, Dilthey, Spengler usw. - bis zu Hitler und Rosenberg.“ (S. 597)[1] Ich verrate jetzt nicht, wer dieser Autor und Professor war und halte mich, aber nur in diesem Falle, an das de mortuis nil nisi bene. Aber einen gewissen Einfluß hatte das schon auf mich. Denn ich sagte mir, wenn der Schopenhauer in der DDR salonfähig ist, dann hat der Lukács womöglich ein bißchen überzogen. Aber das störte mich wenig, denn Schopenhauer konnte ich ja ohnehin nicht leiden.
Mit Nietzsche war das ganz anders. Der war mir verhaßt. Nicht erst nach der Lukács-Lektüre, sondern schon vorher, als ich noch in einem katholischen Priester-Proseminar weilte und dort unmißverständlich zu verstehen bekam: Dieser Nietzsche ist ein Kirchenfeind, ein Antichrist. Lest ihn, aber glaubt ihm kein Wort, auch wenn es sich noch so geistreich zu schmücken weiß. Mit dieser apodiktischen Vorgabe war der Kerl für uns Seminaristen erledigt. Und als wir ihn dann tatsächlich auch lasen, verwandelte sich die Vorgabe ganz schnell in eigene Überzeugung. Tatsächlich, Nietzsche ist durch und durch faschistoid.
Um keinen falschen Eindruck von der römisch-katholischen Erziehung zu erwecken, damals hatte ich noch keine Kirchengeschichtsvorlesungen bei Rosemarie Müller-Streisand gehört und wurde also erst später belehrt, wie das mit dem deutschen katholischen Episkopat und dem Faschismus in Wirklichkeit aussah. Bis 1933 ein entschiedener Gegner der Nazis, war er nach dem Reichskonkordat vom Juli 33 ein ebenso entschiedener Verbündeter, um nach 45 dann prompt wieder die Seiten zu wechseln. Doch die Kirche habe nie, wie Karlheinz Deschner gern sagt, ihre Überzeugung gewechselt, weil es zu ihrer Überzeugung gehört, selbige gegebenenfalls wechseln zu müssen.
Mit ganz anderem Entsetzen denke ich nun aber auch daran zurück, wie Hanfried Müller in den „Weißenseer Blättern“ in die Debatte um eine Nietzsche-Renaissance in der DDR einzugreifen genötigt war. Das war 1987 und ein sicheres Indiz dafür, daß die Konterrevolution tatsächlich schon in der Diele stand. Peter Hacks hätte gesagt: nicht mehr nur „Salpeter im Haus“.
Hanfried Müller schrieb damals in Heft 5/1987, S. 47: „Am 24. November 1987 gegen 19.30 Uhr wurde der Bildschirm der Aktuellen Kamera zum Tribunal. Das Delikt: Schmähung Nietzsches; der Delinquent: Wolfgang Harich; Ankläger und Richter: Stephan Hermlin; das Urteil“ - und das ist ein Hermlin-Zitat: „‚reaktionäre Rückwärtswendung in Richtung auf erledigte Positionen’; Beweismittel: Aufsatz des ‚Reaktionärs’ in ‚Sinn und Form’, Heft 5, 1987, S. 1018-1053 zum Thema: ‚Revision des marxistischen Nietzschebildes?’. Der Prozeß fand öffentlich statt: Vor dem Plenum des Schriftstellerkongresses der DDR.“
Damit es nicht unübersichtlich wird, wiederhole ich noch einmal: Harich wendet sich entschieden gegen eine Revision des marxistischen Nietzschebildes und also gegen eine Entkräftung des Urteils von Lukács. Und Hermlin nennt das eine „reaktionäre Rückwärtswendung in Richtung auf erledigte Positionen“. Daß Nietzsche Antisozialist war, hatte sich also erledigt. Daß er Irrationalist war, hatte sich auch erledigt, daß er Antidemokrat war, Antisemit, Antichrist, Antihumanist - alles hatte sich erledigt, auch seine Verherrlichung des Krieges, die „blonde Bestie“, der „Herrenmensch“, dem Barmherzigkeit ein Schimpfwort war und Mitleid ein Skandal.
In Heft 1/1988,S. 58-61 ist übrigens zu lesen, daß auch der im SED-Politbüro für Ideologie zuständige Kurt Hager die „Weißenseer Blätter“ las und in einem Referat am 14. Januar 1988 vor Lehrkräften des ML-Grundlagenstudiums Hanfried Müllers Beitrag uneingeschränkt zustimmend zitierte. *
1972 konnte ich noch nicht ahnen, daß es einmal so weit kommen würde. Da war meine Welt noch heil. Hätte ich es geahnt, wäre ich ganz sicher nicht so unbefangen mit meinem Kierkegaard umgegangen. Von dem war ich in dieser Zeit viel zu angetan, als daß ich Lukács Urteil widerspruchslos hätte akzeptieren können. Zudem hatte ich vom Schriftsteller Franz Fühmann für eine ganz geringe Gefälligkeit die von Gottsched und Schrempf übersetzte Werkausgabe von 1925 geschenkt bekommen. Und als Student tickt man ja manchmal auch aus ganz verständlichen Gründen irrational. Wie kann man etwas gegen einen Autor haben, dessen Werkausgabe die eigene noch nicht sehr umfangreiche Bibliothek schmückt? Aber es war nicht eigentlich dieser Bücher-Stolz, sondern vielmehr eine innere Nähe zu diesem Dänen, den ich nicht als Philosophen, sondern als Theologen las. Zugegeben: auch als Musiker. Denn ursprünglich war ich ja nach Berlin gekommen, um an der Musikhochschule Hanns Eisler ein berühmter Geiger zu werden. Daraus wurde dann freilich nichts. Wohl auch deshalb nicht, weil ich nicht 12 Stunden am Tag üben konnte und wollte und statt dessen lieber in Konzert und Oper lief. Vor allem in Mozarts Don Giovanni - mit dem wunderbaren Peter Schreier und dem herrlichen Theo Adam. Wie oft, das vermag ich gar nicht mehr zu sagen. Und dann las ich bei Kierkegaard, daß auch er in diese Oper am liebsten täglich gegangen wäre. Und schon war er mein Freund, zumal „Entweder - Oder“ eine ebenso geistreiche wie lustvolle Interpretation des Don Giovanni bietet, die mir mit ihrer Pointe aus dem Herzen sprach: nämlich mit der Problematisierung des läppischen und völlig überflüssig wirkenden Schlußchores, in dem sich das christliche Volk banausisch darüber freut, daß der Don Juan endlich tot ist.
Ich erzähle das alles nur deshalb, weil es die z.T. unübersichtliche Komplexität deutlich macht, in die Entscheidungen für oder gegen einen Autor eingebettet sind. Selbst bei Lukács wird das ja manchmal unübersichtlich, wenn man an so manche seiner frühen Schriften denkt, von denen er sich später z.T. wieder distanziert hat, ohne sie ausdrücklich auf seinen eigenen Index irrationis zu setzten - oder wenn man an seine irrationale Haltung zur Konterrevolution in Ungarn denkt - nur 2 Jahre nach dem Erscheinen seiner epochalen Kritik des Irrationalismus.
Manchmal geht es halt heftig durcheinander, als hätte Lukács womöglich doch ins Schwarze getroffen mit seinem Spitzensatz aus „Die Seele und die Formen“ von 1911. „Es gibt für das Leben kein System“, heißt es da[2]. Und erst, wenn man Hegel gelesen hat, weiß man, wie falsch dieser Satz ist, der vom Widerspruch ebenso absieht wie von aller Bewegung, von aller Dialektik ebenso wie von dem Prozessualen des Lebens, das das System ausmacht.
Es hat also durchaus auch etwas Systematisches, wenn ich ein Jahr nach meiner ersten Lukács-Lektüre bei Franz Fühman, der mir den Kierkegaard schenkte, in „Zweiundzwanzig Tage oder Die Hälfte des Lebens“[3] las, daß es ausgerechnet Lukács war, der ihm für den Marxismus die Augen geöffnet hätte. Und noch zwei weitere Jahre später fand ich dann bei Werner Mittenzwei in dem Reclam-Band „Dialog und Kontroverse mit Georg Lukács“[4], daß der sog. „Sonntags-Kreis“ bei Béla Balázs, in dem Lukács während des 1. Weltkrieges eine dominierende Rolle spielte und 10 von den gewöhnlich 12 Stunden alleine gesprochen haben soll, keinen anderen „Schutzheiligen“ hatte als: Sören Kierkegaard!
Für mich war das Entscheidende bei Kierkegaard sein grundsätzlicher Antiklerikalismus, verbunden mit einer totalen Ablehnung des Staatskirchentums. Daß es das Christsein mit der eigenen Existenz zu tun habe und nicht mit irgendwelchen Institutionen, das war damals für mich eine Kierkegaardsche Grundüberzeugung, die ich völlig teilte, auch weil sie etwas Befreiendes hatte.
Es macht schon einigen Unterschied, ob man Kierkegaard als Theologe liest oder als Philosoph, ob man ihn theologisch oder philosophisch verortet. Die philosophische Tragweite seiner Hegelkritik hatte ich damals kaum verinnerlicht. Daß ihn der Existentialismus als seinen genealogischen Stammvater führt, hatte, so glaubte ich, nicht Kierkegaard zu verantworten. Natürlich wog Lukács’ Wort von der „subjektivistischen Pseudodialektik“ (S. 204) schwer. Aber was Lukács kritisiert, das war für mich innerste Überzeugung, die ich bei Karl Barth auf die paradoxale oder wenn man so will: auf die „pseudodialektische“ Formel der sog. Dialektischen Theologie gebracht fand: „Wir sollen als Theologen von Gott reden. Wir sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen Beides, unser Sollen und unser Nicht-können, wissen und eben damit Gott die Ehre geben.“[5]
Daß auch Kierkegaard in jene Sukzessionskette gehören sollte, die schließlich zu Rosenberg und Hitler führte, das konnte ich nicht so recht nachvollziehen, zumal ich gerade an einer kleinen Seminararbeit über die von Hermann Diem und Paul Schempp gegründete „Kirchlich-theologische Sozietät Württembergs“ saß. Die Sozietät war in der sog. „intakten“, sollte heißen: nicht offiziell von den faschistischen Deutschen Christen regierten württembergischen Landeskirche so etwas wie die BK, die Bekennende Kirche in Preußen. Und Diem und Schempp waren als württembergische Pfarrer nicht nur konsequente Antifaschisten, sondern eben auch radikale Kritiker der kompromißlerischen Kirchenpolitik ihres Landesbischofs Theophil Wurm. Paul Schempp pflegte manche Briefe an das Konsistorium seiner Landeskirche mit dem postalischen Vermerk zu versehen: „An die Gottlosenzentrale“
Und wer war für Hermann Diem der Kronzeuge seiner Widerständigkeit, über den er schon 1929 ein Buch geschrieben hatte? Natürlich Kierkegaard, den er auch gern einen „Spion im Dienste Gottes nannte“ und dessen Werke er im Verständnis eines solchen Diensten nach dem 2. Weltkrieg herausgab. Also: Nicht alle Wege führen nach Rom, nicht immer führen alle Wege nur nach Rom.
Daß mir erst später der Kierkegaardsche Kreuzesmethodismus höchst problematisch wurde und an Hanfried Müllers Seite auch werden mußte, das ist allerdings ein anderes Kapitel, das theologisch zu diskutieren wäre. *
Ähnlich wie mit Kierkegaard ging es mir mit Schleiermacher, dessen „Reden über die Religion - an die Gebildeten unter ihren Verächtern“ von 1799 nicht nur für mich zum Bestseller wurden und ja auch schon den jungen Engels begeistert hatten: „Hätte ich die Lehre früher gekannt, ich wäre nie Rationalist geworden, aber wo hört man so was in unserm Muckertale?“ Und weiter heißt es in dem Brief an Friedrich Graeber vom Juli 1839: „Besonders vor Schleiermacher hab’ ich ungeheure Achtung.“[6] Und nun las ich bei Lukács, dieser Schleiermacher sei der „Vorläufer“ des „modernen religiösen Atheismus“, der sich im „Sinnloswerden des individuellen Lebens“ suhlen würde, einerseits „im berauschenden Gefühl(), ganz auf sich selbst gestellt zu sein“ und sich andererseits einer „trostlosen Verlassenheit“ ausgesetzt zu sehen (S. 355).
Dieses Gefühl war mir nicht unbekannt, nur wußte ich nicht, ob ich meine Pubertät in guter oder in schlechter Erinnerung behalten sollte. Bei Schleiermacher aber konnte ich nichts Pubertäres entdecken. Im Gegenteil. „Hinweg … mit jeder … Verbindung zwischen Kirche und Staat!“ - so sein kirchenpolitischer Imperativ[7]. Das war doch ein Manneswort, das den Konflikt nicht scheute - mit der Kirche nicht und auch nicht mit dem Staat. Trennung von Staat und Kirche - das paßte doch auch ganz trefflich in die DDR. Und dann die Zurückweisung jeglichen Klerikalismus: „Jeder ist Priester“ und „jeder ist Laie“: „ein priesterliches Volk“ ist die wahre Kirche, „eine vollkommene Republik“[8]. Nachdem ich ziemlich frisch vom römischen Katholizismus zum etwas weniger römischen Protestantismus konvertiert war, waren das natürlich Gipfelsätze, die ich unmöglich mit einem verkorksten „religiösen Atheismus“ in Verbindung bringen konnte. Erst sehr viel später, weniger noch durch Karl Barth, der den Schleiermacher theologisch sehr kritisch beurteilte, aber dann mit meiner kursorischen Hegel-Lektüre kam eine grundsätzliche Distanz auf. „Religion als „Sinn und Geschmack fürs Unendliche“[9], als „Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit“ - Hegels lakonisch-karrikierender Kommentar lautete: wenn dem so wäre, „so wäre der Hund der beste Christ“[10]. Noch sehr viel später hat mir dann Peter Hacks den Schleiermacher endgültig problematisiert: Schleiermacher als ein Mann aus dem Klüngel der Romantiker, die sich mit ihrem Aufbegehren gegen die Klassik eigentlich hinter die Französische Revolution zurückfallen ließen. Auf eine solche Idee wäre ich als Student niemals gekommen, denn ich fand diese sinnliche Intellektualität einfach auch hoch poetisch: “Ich liege am Busen der unendlichen Welt: ich bin in diesem Augenblick ihre Seele“[11]. Aber Hacks dürfte wohl recht haben, Hegel ohnehin und Lukács dann sicher auch. Aber von Thomas Metscher wiederum läßt sich lernen, daß die Romantik wohl doch nicht so einfach zu verrechnen ist.
*
Unter uns Studenten fast gar nicht diskutiert, für mich aber nun immer dringlicher wurde die Frage, wie es eigentlich zu der merkwürdigen Diskrepanz kommen konnte, daß viele Autoren, die bei Lukács die Ahnenreihe des Irrationalismus bestimmten, in manchen Vorlesungen wie selbstverständlich zum akademischen Diskurs gehörten. Schopenhauer habe ich schon erwähnt, aber selbst Nietzsche fand da eine Würdigung. In der Ethik, so konnte ich hören und lesen, müßten immer auch die „psychologischen Verschiedenheiten der Menschen“ verrechnet werden. Und so sei, ich zitiere, „ein gewisser Antagonismus der Ethik-Konzeptionen … durchaus sinnvoll und förderlich.“ Und nun wird aufgezählt: „Epikureer gegen die Stoa, Kant gegen Eudämonismus und Utilitarismus, Hegel oder Schiller wieder gegen Kant, Nietzsche wie einige Sophisten gegen die Anwälte des Herkömmlichen“.
Nietzsche - „durchaus sinnvoll und förderlich“. Der Antagonismus zwischen Faschismus und Kommunismus - in der Ethik-Konzeption „durchaus sinnvoll und förderlich“. Mein katholisch geprägtes Urteil über Nietzsche stand ja schon fest, bevor ich nach Berlin kam. Nun aber war ich an einer sozialistischen Universität. Ich hatte zwar meinen vom Vater geerbten sozialdemokratischen Antikommunismus noch nicht vollständig abgelegt, aber das schien mir nun doch eine Ungeheuerlichkeit zu sein. Jedenfalls hat sie mich mehr zum politischen Denken gebracht, als mir damals bewußt gewesen sein dürfte.
Die zitierte Passage steht übrigens im Kontext einer ausführlichen Besprechung der sog. „Lebensformen“ des Eduard Spranger, der 1933 dem „Stahlhelm“ beitrat, dem paramilitärischen Arm der „Deutschnationalen Volkspartei“, die mit Hugenberg die „Harzburger Front“ gegen die Weimarer Republik errichtet hatte. Der „Stahlhelm“ unterschied sich von der NSDAP lediglich darin, daß er der Maskierung als „sozialistische Arbeiterpartei“ nicht zu bedürfen meinte und deshalb viel unverhohlener unter der Firmierung „deutsche Faschisten“ auftrat. Also: Eduard Spranger war ein „deutscher Faschist“. Auf seine in der typologisierenden Lebensphilosophie watenden „Lebensformen“ gehe ich nicht ein. Wohl aber will ich anmerken, wie verwundert ich war, als ich bemerkte, daß Lukács dieses Menschen nicht zu kennen schien. Unvorstellbar, wo er doch alle kannte, aber Spranger kommt bei ihm jedenfalls nicht vor, im Unterschied zu einem gewissen Alfred Baeumler, den Lukács einen „Repräsentanten der offiziellen nationalsozialistischen Philosophie“ nennt (S. 425). Diesen Namen hatte ich bisher noch nie gehört. Später aber las ich irgendwo, daß die Nazis mit dem inzwischen berühmten Professor Spranger nicht immer ganz zufrieden waren und ihm in Berlin deshalb den völlig zufriedenstellenden Professor Baeumler an die Seite gaben. Auch das ließ sich nach dem 8. Mai 45 trefflich verwerten. Und so kam es denn auch dazu, daß die SMAD Spranger kommissarisch zum 1. Nachkriegsrektor der Berliner Universität bestellte.
Der Mißgriff wurde zwar bald bereinigt, aber ich denke heute, vielleicht hat Lukács den Spranger nur deshalb nicht namhaft gemacht, weil der SMAD-Mißgriff sonst um so vergriffener gewirkt hätte. Aber: Wer einmal SMADbestellter Rektor war, den wird man ja wohl noch zitieren dürfen. Und so las ich also in meinem Ethik-Buch Ausführungen von Spranger über Nietzsche - zur Lebensform des sog. „Machtmenschen“. Ich zitiere wieder einmal, jetzt den Spranger als Zitat: „Zuletzt kommen wir zu denen, die die Macht als einen Unwert verneinen und bekämpfen. … Aber es gibt noch eine andere Form des Ressentiments gegenüber der Macht …: den resignierenden Machtmenschen, der sich auf sich selbst zurückzieht und in einer grandiosen Einsamkeit das berauschende Gefühl seiner Größe, seines Unverstandenseins und seiner Unabhängigkeit genießt. … Vielleicht ist Nietzsches Ideal der inneren Mächtigkeit auf diesem Boden erwachsen: aus einer großen Enttäuschung am Menschen überhaupt. … So verkündete der Einsiedler von Sils-Maria der Menschheit, von der er sich losgesagt hatte, den Willen zur Macht.“[12]
Es gab also zu meiner Studentenzeit noch Theologieprofessoren, die sich nicht entblödeten, solche verquasten Zitate in ihre Bücher zu schreiben. Und die wurden in der DDR auch gedruckt. Und offensichtlich ist es keinem Lektor eingefallen zu sagen: wenn der faschistoide Nietzsche Repräsentant einer bestimmten „Lebensform“, eines bestimmten Menschentyps sein soll, dann wäre der Faschismus ja so etwas wie eine anthropologische Konstante.
Ich hatte natürlich auch andere Lehrer an der Universität. Z.B. einen Neutestamentler, der zu Beginn einer Vorlesung, beim einführenden Literaturverzeichnis, darauf aufmerksam machte, daß er den Walter Grundmann nicht zitieren würde, weil dieser noch nicht Buße getan habe. Grundmann war ein Kirchen-Nazi von besonders ekligem Zuschnitt und als Leiter des „Instituts zur Entjudung von Kirche und Theologie“ zuständig für die, so ein Buchtitel, „Entjudung des religiösen Lebens“, zuständig auch für die „Entjudung der Bibel“. Nach 45 erhielt er in der DDR zwar keinen Lehrstuhl, aber er wurde von der Kirche natürlich aufgefangen und durfte in der Evangelischen Verlagsanstalt zahlreiche Kommentare zum NT veröffentlichen, damals ein Standardwerk, aus dem besagter Berliner Neutestamentler niemals zitierte, das er nicht einmal im Literaturverzeichnis angab.
So hatte ich es mir für Nietzsche eigentlich auch vorgestellt, jedenfalls an einer Theologischen Fakultät einer sozialistischen Universität. Die aber bestand eben nicht nur aus Hanfried Müller und Rosemarie Müller-Streisand.
Nicht wenige Studenten hatten ein Theologiestudium aufgenommen, weil sie eigentlich ein, wie es so schön hieß, „Bildungsstudium“ suchten. Dazu gehörten v.a. auch jene, die sich dann 1989 aus dem Pfarramt in die Politik verabschiedeten, nachdem sie zuvor hinreichend „bürgerliche Bildung“ genossen hatten. Nicht alle Namen, die bei Lukács eine Rolle spielen und ja nicht nur bei Studenten als „Bildungsträger“ galten, sind mir aus den ersten Studienjahren erinnerlich. Aber zu Schopenhauer, Nietzsche und Kierkegaard kamen natürlich Dilthey, Freud, Nikolai Hartmann, Heidegger, Jaspers, Malthus, Spengler, Scheler, Troeltsch, Max Weber usw., also die sog. „großen Namen“.
Ich las allerdings auch Namen, die mir gar nichts sagten, z.B. Ernst Krieck, in einem theologischen Band, auch aus der Evangelischen Verlagsanstalt, mit 4 ausführlichen Zitaten, aus seinem 1920 erschienenen Buch „Die Revolution der Wissenschaft“. Und natürlich kommt in einem Zitat auch Nietzsche vor mit seinem, wie Krieck es nennt, „Erkenntniswort“, daß nämlich „dieses Geschlecht“ nur noch „das Kleine gut machen“ könne, daß es doch aber auf das „Ganze und Große“ ankäme. „Der Verfall wird jedermann begreiflich, der Nietzsches Erkenntniswort … bewahrheitet sieht“.
Als Student liest man das relativ arglos und fragt sich höchstens: Wer ist denn Ernst Krieck? Bei Lukács wurde ich belehrt, in dem Kapitel „Präfaschistische und faschistische Lebensphilosophie“. Dort steht Krieck in einer Reihe mit Klages, Jünger, Baeumler, Boehm und Rosenberg. Und auch Lukács zitiert ihn natürlich - aus der „Völkisch politische(n) Antropologie“ von 1936, und da entschlüsselt sich dann das „Große und Ganze“, denn Kriecks Hitlergruß lautet: „Die Persönlichkeit des berufenen Führers ist der Schauplatz, auf dem das Schicksal des Ganzen sich entscheidet.“ Und das „Schicksal fordert den heldischen Menschen der Ehre, der sich jedem Befehl stellt.“ (S. 428) Erst viel später habe ich dann gelesen, daß Ernst Krieck auch Mitarbeiter in Grundmanns „Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das kirchliche Leben“ war, voll der Überzeugung: „Gott spricht … unmittelbar in uns im völkischen Aufbruch.“ (ebd.)
Das ist alles ziemlich widerlich, und völlig unverständlich ist, daß solche Nazis in der DDR zustimmend zitiert wurden und, noch unverständlicher, werden durften. Aber Grundmann konnte ja sogar zum Chefexegeten der Evangelischen Verlagsanstalt avancieren.
*
Wiewohl bisweilen hin- und hergerissen, nach der Lukács-Lektüre fühlte ich mich in meinem Studienjahr zunehmend als Außenseiter, zumal ich bald auch als Müller-Schüler zu gelten begann, weil ich keine seiner Lehrveranstaltungen ausließ, die von vielen Kommilitonen boykottiert wurden, weil „der Müller“ für sie halt einfach „zu links“ war. Und dabei war er nur aufrichtig evangelisch-reformatorisch und politisch völlig klar im Kopf. Eine ganz seltene Kombination, so selten, daß sie dort, wo sie irritiert wahrgenommen wird, fast zwangsläufig unter Verdikt gestellt werden muß. Denn Theologen sind in der Regel politisch nicht völlig klar im Kopf und auch nur ganz gelegentlich evangelisch-reformatorisch.
In der Marx-Engels-Stiftung schickt es sich, Werbung für ein Buch zu machen, das ich nach Müllers Tod 2010 im Schkeuditzer GNN-Verlag herausgegeben habe, Hanfried Müller: „Erfahrungen - Erinnerungen - Gedanken. Zur Geschichte von Kirche und Gesellschaft in Deutschland seit 1945“. Wer Müller aus irgendeinem wundersamen Grunde noch nicht kennen sollte, dem sei der Band wärmstens ans Herz gelegt. Für all jene, die Müller kennen, dürfte er geradezu eine Pflichtlektüre sein, denn diese politische Autobiographie ist hochaktuell und ein Geschichtsdokument von außerordentlicher politischer, theologischer und analytischer Bedeutung.
In ihm kann man u.a. auch lesen, daß Müller ursprünglich einmal über das Thema „Die Zerstörung der Vernunft“ promovieren wollte, über, wie er schreibt, die „Verderbnis der evangelischen Theologie durch den Subjektivismus geistesgeschichtlicher (Dilthey )und existentialistischer Provenienz“ (von Kierkegaard bis Heidegger). Aus politischen und anderen Gründen kam es dann nicht zu dieser Promotion, obwohl der Entwurf der Arbeit bereits vorlag, unter dem Thema „Der Einfluß der Existentialphilosophie auf die Theologie der Gegenwart“. Ich zitiere noch einen Satz: „Dieses Thema wäre übrigens ohnehin 1954 obsolet geworden, nachdem Georg Lukács in seiner ‚Zerstörung der Vernunft’ genau das, was ich ‚entdeckt’ hatte, ungleich viel reifer ausgeführt hatte, als ich es damals gekonnt hätte.“[13]
Übrigens ging es Hanfried Müller ganz ähnlich wie Anna Seghers und Johannes R. Becher. Letztere hatten ja den Plan, Lukács kurz vor dessen Verhaftung nach Berlin zu entführen. Nach der Verhaftung intervenierte Müller bei seinen politischen Freunden im MfS mit der Bitte, und, ich zitiere doch noch einmal, „in naiver Überschätzung ihres internationalen Einflusses“, „dazu zu helfen, daß, wenn über die ungarische Konterrevolution abgerechnet werde, man Lukács gegenüber Gnade vor Recht ergehen lassen möge. Damit, daß es solche revolutionäre Abrechnung gar nicht gäbe, habe ich damals nicht gerechnet!“[14]
Es ist nicht die Prätention des stolzen Schülers, die Müller und Lukács in eine solche Nähe bringen will, sondern lediglich die Aufnahme einer Synopse, die von keinem anderen als von Erich Hahn thematisiert wurde. Sein Grußwort in der 2005 erschienenen „Festschrift zum 80. Geburtstag von Hanfried Müller“ stand unter der ebenso lapidaren wie verbindlichen Überschrift „Hanfried Müller und Georg Lukács“[15]. Was die beiden in ganz intensiver Weise - über alles analytische Denken hinaus - auch biographisch verbindet, das will zunächst erst gar nicht so ins Gewicht fallen, um dann aber doch eine sehr eigene Bedeutung zu bekommen. Lukács war Jude, und Müller mit einer Frau verheiratet, deren jüdische Familie zum großen Teil in Auschwitz ermordet wurde.
Als ich begriffen hatte, daß es bei der Zerstörung der Vernunft letztlich um Auschwitz ging - und nicht um irgendeine Kritik eines rein intellektuellen Prozesses, als ich das begriffen hatte, da war der Lukács für mich nicht mehr nur eine Philosophiekritik, sondern ein durch und durch antifaschistisches Werk.
Geholfen hat mir zu diesem Verständnis ganz maßgeblich Georgi Dimitroff. In meiner Schulzeit hatte ich Dimitroffs Faschismus-Definition allerdings gar nicht verstanden: „die offene, terroristische Diktatur der reaktionärsten, chauvinistischsten, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals“. In meiner Jugend war der Faschismus für mich etwas unvergleichlich Abgründiges, etwas völlig Beispielloses, das alle Kontinuitäten zerbrach, das „Böse“ schlechthin. Und als ich das erste Mal auf Dimitroff stieß, da dachte ich, daß der den Faschismus eigentlich verharmlosen würde - nur am meisten reaktionär, nur am meisten chauvinistisch, nur am meisten imperialistisch. Das widersprach meiner Vorstellung vom Faschismus als einer Kategorie sui generis. Das aber wäre sie ja dann gar nicht mehr, wenn es hier nur um eine Kategorie des reinen Superlativs ginge, eine Kategorie mit Geschichte und Vorgeschichte, mit Traditionslinien, die sich aus Komparativen steigerten, um schließlich superlativ abgründig zu werden.
Nachdem ich das, vermutlich erst in meinem 1. Studienjahr und unter Anleitung z.T. vorzüglicher ML-Dozenten, endlich verstanden und verinnerlicht hatte, konnte ich nun auch den Lukács verstehen und seinen auf mich manchmal auch etwas zelotisch wirkenden Eifer, mit dem er die philosophisch-ideologische Herkunftsgeschichte des Faschismus dokumentiert und seziert. Aber siehe da: Auf die eine oder andere Weise ist fast die gesamte bürgerliche Philosophie und Ideologie in diese Herkunftsgeschichte involviert. Der Faschismus, er ist kein Kind der Hölle, er ist ein Bastard der Bourgeoisie.
Wer solche Zusammenhänge aufgedeckt bekommt, der wird zwangsläufig das, was andere denunziatorisch als „radikal“ bezeichnen. Aber „ex radice“ ist ein gutes Wort, denn man versteht in Geschichte und Gesellschaft ganz und gar nichts, wenn man es nicht von seinen Wurzeln her versteht. Wer Wesen und Erscheinung nicht aufeinander zu beziehen vermag, der bleibt dumm. Und so sieht die Gesellschaft, in der ich nach 1989 zu leben gezwungen bin, denn auch flächendeckend aus.
*
Aber ich will jetzt nicht klagen, sondern mich noch heute darüber freuen, daß ich diesem Lukács begegnet bin. Er hat mich allerdings auch ein wenig verdorben. Denn nach der ersten Lektüre war ich nicht mehr in der bequemen Lage, an der noch zu meiner Studentenzeit dominanten Diskussion über Rudolf Bultmanns sog. „Entmythologisierung des NTs“ mit theologischer Gelassenheit teilzunehmen, denn die Kehrseite dieser Entmythologisierung war eben das, was Bultmann die „Existentiale Interpretation“ nannte. Und allein schon bei dem Lemma „existential“ hatte man aber auch schon den Heidegger im Boot. Und da konnte ich die Frage „Bist du für oder gegen Bultmann?“ nie eindeutig und v.a. nicht emotionslos beantworten.
Natürlich war ich für die Entmythologisierung des NTs, und Bultmann hatte ja auch völlig recht, wenn er betonte: Das „mythische Weltbild ist als solches gar nichts spezifisch Christliches, sondern es ist einfach das Weltbild einer vergangenen Zeit, das noch nicht durch wissenschaftliches Denken geformt ist.“[16] Daß man die im NT erzählten Wunder nicht glauben, sondern kerygmatisch interpretieren muß, war eigentlich selbstverständlich, und ich stimmte mit Bultmanns Frage völlig überein: „Kann die christliche Verkündigung dem Menschen heute zumuten, das mythische Weltbild als wahr anzuerkennen?“ Und die Antwort mußte natürlich lautet: „Das ist sinnlos und unmöglich.“ „Wenn das unmöglich ist“, so Bultmann weiter, „so entsteht … die Frage, ob die Verkündigung des Neuen Testaments eine Wahrheit hat, die vom mythischen Weltbild unabhängig ist; und es wäre dann die Aufgabe der Theologie, die christliche Verkündigung zu entmythologisieren.“[17]
Bis hierhin war alles klar, aber dann wurde es schwierig. Die Entmythologisierung läuft bei Bultmann nun nämlich auf das hinaus, was er, wie gesagt, die „existentiale Interpretation“ nennt, bei der es um „des Menschen Eigentlichkeit“ gehe. Es war nicht nur der Nazi Heidegger, den man plötzlich mithörte, es war auch die eigenartige soziale Destruktion der biblischen Botschaft, denn das NT spricht doch niemals von des Menschen „Eigentlichkeit“, ohne nicht zugleich und vor allem von der „Eigentlichkeit“ der menschlichen Polis zu reden. In der Bibel ist der Mensch niemals jenseits seiner Kommunität. Und wo von der Erneuerung des Menschen die Rede ist, da geht es immer auch um die Erneuerung seiner Gemeinschaft. Und nun hatte ausgerechnet Bultmann einen neuen Mythos geschaffen: einen Existenzmythos, der von des Menschen „Eigentlichkeit“ redet, als wäre diese ohne Sozialität zu haben.
Ich erzähle die Begebenheit von einem mit Lukács gelesenen Bultmann auch deshalb, weil mir erst viele Jahre später aufging, daß ich dem Bultmann womöglich immer Unrecht getan habe. Natürlich hat Lukács recht. Der Existentialismus, welcher Art auch immer, ist irrational, jedenfalls immer dann, wenn er die „Existenz“ entsozialisiert. Aber so wie ich Lukács als Blaupause einst auch über Bultmann legte, habe ich dessen eigentliche Intention wahrscheinlich völlig verdeckt.
„Wenn ein Theologe noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts die Berücksichtigung eines wissenschaftlichen Weltbildes einfordern muß, dann hat er es offensichtlich mit einer Kirche und mit einer Gesellschaft zu tun, in der Irrationalität zu ihrer ideologischen Verfaßtheit gehört. Und natürlich wurde 1941 im ‚Deutschen Reich’ weltanschaulich nicht rational gedacht, nicht einmal von den den Endsieg vorbereitenden Atomphysikern, die lediglich auf ihre Laborrationalität fixiert waren. Eigentlich gab es, mehrheitlich gesehen und im umfassenden Sinne, den von Bultmann apostrophierten ‚modernen Menschen’ gar nicht.“ Was es herrschend gab, das war der ‚Mythus des 20. Jahrhunderts’ des Herrn Alfred Rosenberg. „Um so bedeutsamer wird Bultmanns Engagement für diesen“, wie er sagt, „‚Menschen heute’, das auch als ein Engagement für ihn und also gegen seinen Irrationalismus gesehen werden kann.“[18]
Und dann wurde mir auch klar, warum ein so brillanter Exeget wie Rudolf Bultmann über die für das NT konstitutive Kommunität einfach hinweggehen und auf den Subjektivismus einer „existentialen Interpretation“ kommen konnte. Sehr wohl verständlich wird das, wenn die „existentiale Interpretation“ begriffen wird als eine Aufforderung zu einer „inneren Emigration“ und also zum geistigen Rückzug aus einem Staat, der in seiner abgrundtiefen Verdorbenheit nicht mehr erneuerbar war und nur noch untergehen mußte. So gesehen, hätte Bultmann 1941 immerhin den welterobernden »Deutschen Mythos« mit einem weltlosen „Existenzmythos“ konfrontiert.
Genau hier liegt der antagonistische Unterschied zu Heidegger. Während Bultmanns Verständnis des Existentialen gerade zu einer Immunisierung gegenüber dem faschistischen Mythos führen sollte, führte „Sein und Zeit“ (1927) den Autor in die NSDAP. In einem berühmt gewordenen Brief an Karl Kerényi schrieb Thomas Mann im November 1941: „Man muß dem intellectuellen Fascismus den Mythos wegnehmen und ihn ins Humane umfunktionieren. Ich tue längst nichts anderes mehr.“[19] Dieses ließe sich - mutatis mutandis - auch für Bultmann geltend machen, der den faschistischen Mythos faktisch mit dem weltverachtenden Existenzmythos der Gnosis konfrontierte und im (gnostisch und also auch antirömisch gestimmten) Johannes-Evangelium seine authentische Vorlage gefunden zu haben meinte.
*
Ich erzähle das so relativ ausführlich, weil ich auch von jenen Irrtümern berichten möchte, in denen ich nach der Lukács-Lektüre lange gefangen war.
Andere irrten allerdings auch, ganz gelegentlich sogar Lukács selbst, wenn er in Kafka einen „literarischen Vertreter der nihilistischen Verzweiflung“ (S. 619) sieht. Ich bin mit Kafka aufgewachsen, weil ich als Knabe den in meiner sozialistischen Kleinstadtbibliothek vorhandenen Titel „Das Schloß“ zunächst für einen Königsroman hielt und dann natürlich schrecklich enttäuscht war. Aber nicht nur enttäuscht, denn wie dieser Mensch erzählen konnte, das hatte es mir angetan. Und dann war da noch der Bibliothekar, der mir bedeutete, aus der sozialistischen Kreisstadtbibliothek auch noch andere Kafka-Bücher kommen lassen zu können. Und ich solle das alles mal schön lesen, denn dann würde ich nicht immer so antikommunistisch daherreden, sondern begreifen, wie deprimierend der Kapitalismus ist.
Seitdem gehört Kafka für mich zu der Wolke der Zeugen wider diesen Kapitalismus, denn in der sich in seinem Werk spiegelnden Verzweiflung ist er gerade nicht nihilistisch, sondern anklagend. Das habe ich mit Hanfried Müller nie ohne Dissens diskutieren können, wie ich andererseits mit Hans Heinz Holz auch nie über Nietzsche einig wurde, der bei Lukács manchmal neben Dostojewski zu stehen kommt. Viel später erlebte ich in Lukács Autobiographie allerdings eine große Überraschung. Da heißt es nämlich, Dostojewski habe ihn, so Lukács rückblickend, „darin unterwiesen, wie man in der Literatur ein ganzes System in Bausch und Bogen verurteilen kann“. Bei ihm sei „nicht davon die Rede, daß der Kapitalismus die und die Fehler habe, sondern … Dostojewskis Meinung zufolge ist das ganze System, so wie es ist, unmenschlich“[20]. Genau das sollte ich nach Ansicht meines Bibliothekars auch bei Kafka lernen.
*
Ich mache hier einen Schnitt, weil die Zeit vergeht und ich noch etwas zu meiner 2. Lukács-Lektüre sagen möchte. Die ist ganz frisch, die Vorbereitung auf dieses kleine Erinnerungsreferat. Im Ohr hatte ich dabei natürlich immer auch den von Peter Hacks verliehenen Hoheitstitel - Lukács, ein „normengebender Anführer des Geistes“[21]. Und in der Tat: Die „Zerstörung der Vernunft“ ist eines der für mich wichtigsten Werke, die ich je in der Hand hatte. Und aus der heutigen Distanz zu meiner ersten Lektüre sage ich auch gern: selbst von Lukács’ Irrtümer läßt sich einiges lernen. Na gut, ein paar Kleinigkeiten lasse ich außen vor. Z.B. seine Überzeugung, daß Lyssenko Darwin weiterentwickelt habe (S. 82) - oder daß die, wie er sagt, „a-kausale Elektronenbewegung“ typischerweise eine Theorie „bürgerlicher Atomphysik“ sei, der ein Schopenhauer ganz sicher „begeistert zugestimmt“ hätte (S. 184 f.).
Nach 4 Semestern hatte ich ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt protestantischer Theologie kennengelernt. Später ließ sich dann das ganze Ausmaß ihrer Verwerfungen überblicken. Wie die bürgerliche Philosophie, so ist auch die bürgerliche Theologie, ist auch die bürgerliche Kirche im Faschismus gelandet. Natürlich gab es immer auch Irreguläre, mit deren Namen man sich heute auch gerne schmückt, als wäre ein Dietrich Bonhoeffer geistiger Repräsentant der offiziellen Kirche gewesen. Die großen Ausnahmen muß man schon suchen. Und wenn Friedrich-Martin Balzer heute unter uns wäre, dann würde er ganz laut den Namen Erwin Eckert rufen. Natürlich, das war so eine Ausnahme, mit der man sich nun aber gar nicht schmücken kann, denn Pfarrer Eckert trat 1931 der KPD bei.
So etwas geht nun gar nicht in einer Kirche, für die Antikommunismus geradezu ein Dogma war - aber was sage ich: nicht nur war, sondern immer noch ist. Nietzsche stammte aus einer protestantischen Pfarrerdynastie. Daß er die Kirche haßte, läßt sich also familienpsychologisch ganz gut verstehen. Aber zugleich hat er mit seinem Antisozialismus die väterliche Kirche auch glänzend repräsentiert. Das Ergebnis ist auch bekannt. Im Unterschied zur römisch-katholischen Kirche hat die protestantische die Arbeiterklasse fast völlig verloren. Daran änderte auch das sog. soziale Engagement bestimmter kirchlicher Kreise nichts, denn Protagonisten wie Johann Hinrich Wichern, der Hofprediger Adolf Stoecker und ein Friedrich Naumann waren sich in einem einig: Wenn wir die soziale Not nicht lindern, dann kommt die Revolution - Gott behüte. Ein bis heute wohlbedachtes Motiv, nicht nur der sog. Christlich-Sozialen.
Mit Stoecker haben wir zugleich einen widerlichen Antisemiten im Gepäck, der den von Lukács verhörten Gobineau und Chamberlain in nichts nachsteht. Einer der geistigen Initiatoren des späteren Arierparagraphen in der faschistischen Kirche. Antikommunisten waren sie alle und Sozialdarwinisten fast alle, nicht nur Herr Naumann von der FDP-nahen Stiftung. Und spätestens 1914 waren sie alle auch Militaristen.
Es macht keinen Spaß, über diese Kirche von Thron und Altar zu berichten. Als ich den Lukács jetzt wieder las, war es wirklich deprimierend, noch einmal vor Augen geführt zu bekommen, daß sich die Wege von Kirche und Welt in nichts unterschieden.
Natürlich läßt sich feinsinnig über Diltheys Einfluß auf die theologische Hermeneutik reden - über Jaspers Grenzsituationen, die ein Helmut Thielicke dann zu einer Programm-Theologie erhoben hat. Jener Thielicke, der sich geradezu konfessorisch für eine atomare Bewaffnung der Bundesrepublik aussprach - und Predigten, die er vor 45 gehalten hatte, nach 45 mit antinazistischen Zusätzen herausgab[22].
*
Auch das macht alles keinen Spaß. Und deshalb will ich gegen Ende meines kleinen Beitrags lieber noch etwas ganz anderes thematisieren - nämlich Lukács selbst. Ich bin mit seiner großartigen Genese des Irrationalismus völlig d’accord. Die ist so fundamental, daß es auch gar nicht wichtig wird, ob er hier und da womöglich auch zu streng geurteilt hat. Später hat er ja auch so manches revidiert - etwa sein Urteil über Nikolai Hartmann. Aber nicht revidieren lasse ich mir sein großartiges Nachwort, das auf die Erkenntnis geht: Der US-amerikanische Imperialismus ist eine demokratisch gehaltene Variante des Faschismus. Das hatte mir als Student schon der Vietnamkrieg bestätigt, und danach wurden die Belege Legion. Heute haben wir es zudem mit weltweit agierenden Börsenfaschisten zu tun.
Doch siehe da: Als ich im Herbst 1984 nach vierjähriger Arbeit im internationalen Prager Stab der CFK, der Christlichen Friedenskonferenz, nach Berlin an die Humboldt-Uni zurückkehrte, wurde ich von der Universitätszeitschrift um einen Artikel über die internationalen Friedensarbeit gebeten. Den lieferte ich auch ab, nur gedruckt wurde er nicht, denn ich hatte in ihm - ganz im Geiste Lukács’ - behauptet, daß es eine verhängnisvolle Illusion sei, anzunehmen, es könne mit dem Imperialismus eine friedliche Koexistenz geben.
1954 konnte Lukács noch der festen Überzeugung sein, daß sich „die Gesamtlage“ „radikal geändert“ habe und die Vernunft vom Katheder endlich massenhaft auf die Straße gestiegen sei (S. 669). 30 Jahre später begann sie selbst aus sozialistischen Parteizentralen wieder auszuziehen, und nach weiteren 5 Jahren tobte sich auf den Straßen wieder völkische Dummheit aus.
Auch das nicht ohne intellektuelle Vorgeschichte. Ich hatte leider nicht die Möglichkeit, herauszufinden, welche von Lukács auf den Index des Irrationalismus gesetzte Autoren in dieser Zeit in der DDR wieder literaturfähig wurden, v.a. durch den Leipziger Reclam-Verlag, dem heute bescheinigt wird, versucht zu haben, „die Grenzen des in der DDR noch Erlaubten auszuloten“[23]. Und spektakulär war das schon, daß plötzlich ein Wilhelm Dilthey auf dem Programm stand: „Das Erlebnis und die Dichtung“, 1988. Wenn schon nicht Nietzsche, wie Hermlin wollte, dann eben erst Dilthey. Noch eigenartiger aber war, daß schon 1985 ein Band ausgewählter Schriften von Georg Lukács erschien, zum 100. Geburtstag - herausgegeben ausgerechnet von Sebastian Kleinschmidt.Verdienstvoll, würde man zunächst sagen wollen. Aber bezeichnenderweise sind das fast alles Lukács-Texte aus der Frühzeit, von denen er sich später weitgehend distanziert hatte. Oder Veröffentlichungen in der Bundesrepublik, die manchmal auch ein bißchen staunend machen: Heinrich Bölls „Billard um halbzehn“ sei „eine der wenigen menschlich echten Bewältigungen der faschistischen Vergangenheit in Deutschland“[24]. An die „Zerstörung der Vernunft“ erinnert in diesem Auswahlband - im Unterschied zu dem 1977 von Mittenzwei bei Reclam herausgegebenen - eigentlich nichts mehr. Und das sollte wohl auch so sein, denn der Herausgeber Kleinschmidt hoffte ja, wie es im Vorwort heißt, „auf einen Leser, der sich nicht mehr genötigt fühlt, innerhalb unfruchtbarer Alternativen zu manövrieren“[25].
Übrigens, und das will ich doch auch noch wenigstens anmerken: Pünktlich zum Schlußverkauf erschien 1989 bei Reclam Horkheimers und Adornos „Dialektik der Aufklärung“. Und das war es dann.
Ich werde wortbrüchig, denn ich wollte ja nicht mehr über Dinge reden, die keinen Spaß machen. Aber worüber kann man dann eigentlich noch reden? Selbst jenes Thema, das mir bei Lukács besonders am Herzen liegt, ist nicht sonderlich erbaulich. Ich meine Lukács’ Hegelinterpretation. Als ich „Die Zerstörung der Vernunft“ zum ersten Mal las, hatte ich an seiner Gegenüberstellung von Idealismus und Materialismus noch gar nichts auszusetzen. Schließlich hatte ich das ja auch so gelernt: Hegel ist ein Idealist, immerhin ein objektiver und nicht, wie etwa Kant, nur ein subjektiver, aber eben ein Idealist. Und das hieß nach Friedrich Engels: Beim Idealismus geht das Bewußtsein dem Sein voraus, beim Materialismus ist es gerade umgekehrt. „Grundfrage der Philosophie“[26]. Ich habe das lange so hingenommen, bis ich Hegel zu lesen begann und nicht mehr verstehen konnte, warum das die Grundfrage sein sollte. Wie soll denn das Bewußtsein dem Sein vorausgehen? Engels hat ja völlig recht, wenn er die Grundfrage in dem „Verhältnis von Denken und Sein“[27] bestimmt. Aber bei dieser Bestimmung kann es doch unmöglich um eine Prioritätenfrage gehen. Selbst Schelling stellt doch ganz unmißverständlich klar: „das Sein ist das erste, das Denken erst das zweite oder folgende“. (S. 146[28]) Dem hätte auch Kant nicht widersprochen, und für Hegel ist es selbstverständlich. Also: was heißt jetzt Idealismus? Und wie kann man so ohne weiteres Denken, Geist und Bewußtsein einfach unterschiedslos in eins setzen? Für Hegel ist der Geist das Organisationsprinzip der Materie, und als solches kommt er im Denken zu Bewußtsein. Aber das ist etwas ganz anderes, als in Engels’ Frage unterlegt ist: „Was ist das Ursprüngliche, der Geist oder die Natur?“[29] Natürlich, gegenüber einem schlichten Kreationismus darf man vielleicht so fragen, vorausgesetzt, man stellt sich auf dessen schlichte Prämissen, aber für die Philosophie ist diese Frage doch völlig insuffizient, erst recht für die „neuere Philosophie“, auf die Engels besonders abhebt, denn sie geht an dem Verhältnis von Denken und Sein vorbei. Das definiert sich nicht in Vor- oder Nachordnung; die Ordnung versteht sich von selbst. Und erst jetzt wird es eigentlich grundsätzlich, wenn es nämlich um die Fragen geht: wie und in welchem Umfang und mit welcher Klarheit und auch aus welchem Grunde ist das Sein im Bewußtsein präsent.
Das sind Hegels Fragen. Und die lassen sich im Blick auf die Totalität des Seins und also im Blick auf das, was Engels den „Gesamtzusammenhang“ nennt[30] nicht empirisch beantworten, sondern nur, um einen trefflichen Begriff von Marx einzusetzen, als „Gedankentotalität“[31]. Und eine solche „Gedankentotalität“ ist Hegels Philosophie. Die läßt sich, mit Verlaub, nicht vom Kopf auf die Füße stellen, weil man mit den Füßen nicht denken kann. Deshalb spreche ich über Hegel auch nicht als von einem objektiven Idealisten, sondern von einem Idealisten der objektiven Realität. Und wer auch immer über die objektive Realität in ihrer Totalität und also über das Absolute spricht, der wird die Idee des Absoluten notwendigerweise als eine im Hegelschen Sinne „idealistische“ Kategorie verwenden müssen. Wohlgemerkt, im Hegelschen Sinne und nicht in jenem Sinne, den Lukács Hegel durchgängig unterlegt. Das ist das eine, was ich an ihm ernsthaft kritisiere, daß er Hegel eingebunden hat in die schlichte und redundante Formel: „Idealismus oder Materialismus, Priorität von Sein oder Bewußtsein“ (S. 146), das sei „die einzig richtig und klar gestellte erkenntnistheoretische Frage“ (S. 351).
Das andere ist dieses - und nun mache ich mich gern noch angreifbarer. Mit Hegel weist Lukács Kants Agnostizismus zurück, also die These, daß man das sog. „Ding an sich“ letztlich nicht erkennen könne. Sofern es bei Kant dabei darum geht, eine prinzipielle Erkenntnisschranke zu setzen, sind ja auch beide völlig im Recht. Was ich aber bedauere, ist, daß Lukács an dieser Stelle nicht mit Hegel über Hegel hinausgeht. Wenn, wie Hegel sagt, alles Sein im Werden ist und das Eine nur im Anderen mit sich identisch wird, wenn also Sein in toto eine universale Relationalität ist, dann kann es gar keine „Dinge an sich“ geben, denn dann ist alles dieser Relationalität unterworfen - und heute ist ein sog. Ding dieses und vielleicht schon morgen etwas anderes. D.h. unsere Erkenntnis geht nicht auf irgendein „Ding an sich“, sondern auf die Relationalität an sich. Philosophie hat es mit einer Welt zu tun, die nicht durch Objekte konstituiert ist, sondern durch Beziehungen. Nicht Sachen, sondern Sachverhalte gehören zu ihrem Thema.
Ich weiß, daß Lukács’ aus ganz anderen Gründen heftig kritisiert wurde und nicht nur so prominent und zutreffend wie einst von Lenin. Auch sein 1948 in Zürich und ebenfalls 1954 dann auch in der DDR erschienenes Werk „Der junge Hegel“ fand seine Kritiker. Ein vortreffliches Buch gegen die, wie er grimmig schreibt, „Dilthey, Nohl und Konsorten“[32] - in dem er allerdings ein wenig auch gegen Marx anschreibt, der die „Phänomenologie des Geistes“ - in der heiligen Familie - für ein „destruktives Werk“ hielt, das „die konservativste Philosophie zum Resultat“ habe[33]. Demgegenüber zeigt Lukács gerade das Konstruktive der „Phänomenologie“, das da u.a., gegen Schelling gerichtet, lautet: Dialektik ist keine Frage elitärer Begabung, sondern der Bildung. Dialektik ist lehr- und lernbar.
Und dann sind da noch Lukács’ interessante Widersprüche, die man klein, aber auch ganz schön groß nennen könnte. Hegel ist ein Idealist in dem von Engels beschriebenen Sinne - einerseits. Doch andererseits finden wir in der „Zerstörung der Vernunft“ solche erstaunlichen Sätze wie diesen: Das „Wesen der Hegelschen dialektischen Methode“ ist eine „Selbstbewegung des Begriffs, … die für etwas Transzendentes weder in der Natur noch in der Geschichte einen Spielraum offen läßt“. (S. 144) Also, Hegel doch kein Idealist?
1954 stand für manche DDR-Philosophen jedenfalls fest, daß Lukács ein Revisionist ist. Und in einem guten Sinne kann man das durchaus auch sagen, denn das es etwas zu revidieren gab, das zeigen die Anwürfe des Leipziger Ordinarius Rugard Otto Gropp in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie[34]. Man kann sich das Nachlesen ersparen. Höchstens könnte man fragen, warum nicht eigentlich auch Lenin unter Revisionismusverdacht gestellt wurde. Denn sein berühmtes Diktum in dem Konspekt zu Hegels „Wissenschaft der Logik“ gibt das schon her, wenn man ihn nicht versteht: „Das Bewußtsein des Menschen widerspiegelt nicht nur die objektive Welt, sondern schafft sie auch.“[35] Das könnte ja ganz verdächtig nach einem „dritten Weg“ klingen, mit dem wiederum Lukács die Lebensphilosophie seines einstigen Gesprächspartners Georg Simmel charakterisiert, weil der meinte, eine neue Grundfrage aufgeworfen zu haben: „Ist das Bewußtsein vom Leben oder das Leben vom Bewußtsein abhängig?“ (S. 351)
Jetzt geht wieder einiges crossover. Und das ist zum Schluß meiner Ausführungen vielleicht auch ganz angemessen, denn bei Lukács selbst geht unheimlich vieles crossover, eben weil seinem Werk wirklich Universalität eignet. Da läßt sich unglaublich vieles finden, und manches befindet sich dann auch in Spannung - eben weil das Bewußtsein vom Leben und das Leben auch vom Bewußtsein abhängt, um auch gleich eine Antwort auf Simmels schlichte Grundfrage zu geben. Aber wenn ich Lukács rühmen sollte, dann weniger ob dieser Universalität, sondern wegen seines leidenschaftlichen Plädoyers wider die Zerstörung der Vernunft, obgleich diese Vernunft vorerst einen unrühmlichen Abschied aus der Geschichte genommen hat.
[1] Die im Text in Klammern angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf: Georg Lukács, Die Zerstörung der Vernunft, Aufbau-Verlag, Berlin 1954. [2] Berlin 1911, S. 70. [3] Rostock 1973. [4] Leipzig 1975. [5] K. Barth, Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie (1922), in: Ders., Gottes Freiheit für den Menschen. Eine Auswahl der Vorträge, Vorreden und kleinen Schriften. Mit einem Geleitwort von Günter Jacob, Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1970, S. 85. [6] MEW, Ergänzungsband 2, S. 403 u. 408. [7] Werke Schleiermachers, ausgewählt und eingeleitet v. Hermann Mulert, Berlin 1924, S. 130. [8] Ebd., S. 111. [9] Ebd., S. 46. [10] HW 11, S. 58. [11] Werke Schleiermachers, a.a.O., S. 57. [12] Eduard Spranger, Lebensformen, Halle 1922 (3. Aufl.), S.208 ff. [13] Müller, S. 154. [14] Müller, S. 187, Anm. 117. [15] Aus Kirche und Welt. Festschrift zum 80. Geburtstag von Hanfried Müller, Berlin 2005, S. 28 ff. [16] Rudolf Bultmann, Neues Testament und Mythologie. Das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung, in: Hans-Werner Bartsch (Hg.), Kerygma und Mythos. Ein theologisches Gespräch [1948], Hamburg 1960 (4. Aufl.), S. 15-48, (Theologische Forschung 1), hier S. 16. [17] Ebd. [18] Dieter Kraft, Mythos und Ideologie. Zum politischen und theoretischen Umgang mit einer griechischen Vokabel, in: Topos 31/ Napoli 2009, S. 25. [19] Zitiert nach Manfred Frank, Der kommende Gott. Vorlesungen über die Neue Mythologie, Teil 1, Frankfurt a.M. 1982, S. 32. [20] Georg Lukács, Gelebtes Denken. Eine Autobiographie im Dialog, Frankfurt a.M. 1981, S. 75. [21] Vgl. Jens Mehrle: Zur Lehre vom Gemeinsamen Boden, in: Topos 23 / Napoli 2005, S. 47. [22] Helmut Thielicke, Der Glaube der Christenheit. Unsere Welt vor Jesus Christus, Göttingen 1955 (3. Auflage). [23] http://de.wikipedia.org/wiki/Reclam-Verlag [24] Georg Lukács, Über die Vernunft in der Kultur. Ausgewählte Schriften 1909-1969, Leipzig 1985, S.435. [25] Ebd., S. 6. [26] MEW 21, S. 274 (Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, 1886/88) [27] Ebd. [28] Abhandlung über die Quelle der ewigen Wahrheiten (1850) - Gelesen in der Gesamtsitzung der Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 17. Januar 1850. [29] MEW 21, S. 275. [30] MEW 19, S. 207. [31] K. Marx, Grundriß der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1953, S. 22. [32] Georg Lukács, Der junge Hegel und die Probleme der kapitalistischen Gesellschaft, Berlin/Weimar 1986 (2. Aufl.) S. 34. [33] MEW 2, S. 203. [34] 1/1954, S. 69 ff. [35] LW 38, S. 203. |
|
|